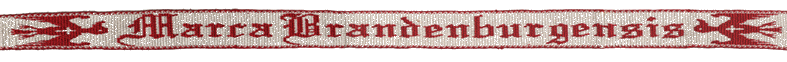
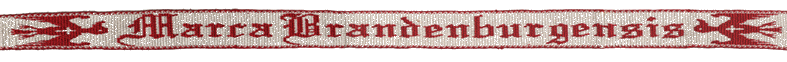
Was Knochen & Co. verraten:
Osteoarchäologie, Paläopathologie und Paläoanthropologie
Methoden und Erkenntnisse mit Bezug zur mittelalterlichen Geschichte der Mark Brandenburg
Ruth M. Hirschberg
Berlin, Mai 2013
ergänzt: August 2013
Knochen spielen in der Archäologie
eine besondere Rolle –Skelettanteile sind in der Regel das einzige, was direkt
von den Menschen vergangener Zeitstellungen übrig bleibt. Aus ihnen lässt
sich allerdings eine Vielzahl von biologischen und historischen Informationen
über die damaligen Menschen selbst ablesen, und oft ergeben sich daraus
auch Hinweise über ihr soziokulturelles Umfeld. Allerdings präsentieren
sie sich oft in Form von „Knochenpuzzles“ und müssen erst mühsam identifiziert
und klassifiziert werden.
Ähnliche Aufschluss Aufschlüsse liefern Funde von menschlichen Leichenbränden,
Mumien oder Moorleichen. Als besonders instruktiv können sich auch noch
andere „Hinterlassenschaften“ erweisen: Koprolithen oder Kotsteine, die aber
zum Glück in der Regel nicht mehr „anrüchig“ sind... So werden in
Kooperation der verschiedenen verwandten Wissenschaftsdisziplinen Fakten erarbeitet,
die dann zur Rekonstruktion ganzer Lebenswelten führen können.
Wissenschaftsbereiche, Datenerhebung und Methoden
Die Bearbeitung dieser menschlichen Überreste wird als sogenannte Prähistorische Anthropologie bezeichnet. Sie ist ein Teilbereich der Osteo-, Zoo- oder Bioarchäologie, oder wird auch als Paläoosteologie bezeichnet. Unter diesen Begrifflichkeiten fasst man die Untersuchung sämtlicher knöcherner (oder sonstiger hartgeweblicher, s.u.) Überreste von Menschen und Tieren (und gegebenenfalls Pflanzen) zusammen. Gerade der Vergleich menschlicher Überreste mit denen von Tieren und Pflanzen aus demselben Fundkomplex ergibt wertvolle Hinweise auf Nahrungsspektrum und Lebensweise (Jäger und Sammler, nomadische Hirten, sesshafte Bauern, Händler etc.) der jeweils ergrabenen menschlichen Gesellschaft oder Gruppe. Die Verknüpfung der Erkenntnisse aus diesen verwandten Disziplinen wird neuerdings als Paläoökonomie zusammengefasst. Das verwendete Methodenspektrum reicht dabei von der der so genannten Osteologie über Spurenelementanalysen bis hin zur Paläogenetik. Dabei ist es besonders wichtig, dass die bearbeitenden PaläoosteologInnen bereits bei der Ausgrabung dabei sind, da zum Beispiel mit Hilfe von Falschfarben-Fotographie oder Phosphat-Methoden auch so genannte „Leichenschatten“ und solche Bestattungen dokumentiert werden können, die wegen fehlender Skelettreste dem menschlichen Auge verborgen bleiben würden.
Osteologie und Osteometrie
Die Untersuchung von Knochen (= Osteologie) und deren genaueste Vermessung (= Osteometrie) ermöglicht – abhängig vom jeweiligen Erhaltungszustand und der Vollständigkeit - die Rekonstruktion verstorbener Menschen (und Tiere) anhand des vorhandenen Knochenmaterials. Die Paläoanthropologie erschließt mittels dieser Techniken primär individuelle Daten wie Sterbealter, Geschlecht und Körperhöhe anhand bestimmter menschlicher Skelettcharakteristika.
Zunächst wird möglichst der gesamte Fundzusammenhang sowie die Individualität
der einzelnen Knochen bestimmt. Bei Massenbestattungen (z. B. bei Schlachtfeldern)
oder Überschneidung von Fundhorizonten (z. B. durch zeitlich nachfolgende
Mehrfachbelegung von Grabstätten) kann es schwierig sein zu entscheiden,
ob die zu untersuchenden Knochen zu einem oder mehreren Individuen gehören.
Sterbealtersbestimmung:
Für die Sterbealtersbestimmung wird eine Einordnung in die jeweiligen Körperentwicklungsphasen
des Individuums vorgenommen: Handelt es sich um Säuglinge, Kleinkinder
und Kinder (infante Phasen, I: bis 7 Jahre, II: 7-13 Jahre), Heranwachsende
(juvenil, 13 -18/20 Jahre), Erwachsene (adult, 18/20-40 Jahre), ältere
Erwachsene (matur, 40-60 Jahre) oder alte Menschen (senil, über 60 Jahre).
Die Zähne spielen dabei eine wichtige Rolle: Aus den härtesten Substanzen
des Körpers zusammengesetzt (Zahnschmelz, Zahnbein und Zahnzement) besitzen
sie einerseits eine verhältnismäßig hohe Beständigkeit
im Boden und bleiben damit häufiger als andere Skelettelemente erhalten.
Andererseits erlauben sie anhand ihres Mineralisationsgehaltes (chemische Analyse),
ihrer Struktur (Strukturanalyse der Hartgewebe) und anhand ihres typischen Abriebs
eine Sterbealtersbestimmung. Am Beispiel des Zahnabriebs können allerdings
auch die Probleme bzw. die Grenzen der osteologischen Altersbestimmung verdeutlicht
werden: Aufgrund unterschiedlicher Nahrung und Kauverhaltens kann der Zahnabrieb
bei Menschen gleichen Alters sehr unterschiedlich sein – nimmt man überwiegend
weiche und bereits durch Zerkleinerung oder Kochen aufgeschlossene
Nahrung zu sich, verringert sich der Zahnabrieb erheblich. Deshalb unterscheidet
man auch zwischen biologischem und chronologischen Alter: das biologische Alter
berücksichtigt besondere ‚Belastungen‘ des Körpers – z. B. harte körperliche
Arbeit oder auch Fehl- oder Mangelernährung -, die dann zu ‚vorzeitigen‘
Alterungserscheinungen führen können. Das chronologische Alter entspricht
dagegen dem kalendarischen Alter. Für die prähistorische Anthropologie
ist es oft nicht möglich, das biologische vom chronologischen Alter zu
differenzieren.
Für die Sterbealtersbestimmung von Kinderskeletten wird zunächst der
jeweilige Stand des Gebisswechsels (Durchbruch bzw. Wechsel der jeweiligen Milch-
und bleibenden Zähne) und die Zahngröße herangezogen. Die Länge
der großen Röhrenknochen (Oberarm, Oberschenkel) liefert hierzu ebenfalls
wichtige Daten, genauso wie der Schluss der so genannten Wachstumsfugen am Skelett:
Das noch wachsende Skelett weist an bestimmten Stellen Knorpeleinschlüsse
auf, die insbesondere das Längenwachstum ermöglichen. Erhalt oder
‚Schluss‘dieser Fugen (damit ist der Ersatz von Knorpel durch Knochen gemeint)
erfolgt an den verschiedenen Knochen des Körpers nach einem bestimmten
zeitlichen ‚Muster‘, das allerdings ebenso wie am Beispiel Zähne erläutert
auch anderen Einflüssen, wie beispielsweise Ernährungslage und Hormonstatus,
unterliegt. Die Altersbestimmung erwachsener Individuen erfolgt in ähnlicher
Weise anhand des so genannten ‚Nahtschlusses‘ der Schädelknochen: Der Schädel
besteht aus einzelnen Knochen, die über die ‚Schädelnähte‘ zunächst
gegeneinander verschieblich sind. Im Laufe des Lebens verknöchern und verstreichen
diese ‚Nähte‘ zwischen den Einzelknochen nach einem recht konstanten ‚Muster‘
und erlauben damit ebenfalls eine Sterbealterseingrenzung. Auch andere Verknöcherungsvorgänge
am Körper sind hier wichtig, so die Verknöcherung der ‚Fuge‘ zwischen
rechtem und linken Schambeinanteil oder die Verknöcherung der knorpeligen
Anteile der Rippen. Be- und überbelastungsbedingte Veränderungen am
Skelett, vor allem an Wirbelsäule und Becken und generell den großen
Gelenken des Körpers, ergeben ebenfalls wertvolle Hinweise zur Alterseinschätzung.
Geschlechtsbestimmung:
Die Geschlechtsbestimmung erhaltener Skelette ist ebenfalls möglich, aber
oft schwierig, wenn nur Skelettfragmente untersucht werden können bzw.
wenn es sich um kindliche Skelette handelt. Zunächst kann die so genannte
‚Robustizität/Fragilität‘ der langen Röhrenknochen beurteilt
werden. Man geht hierbei von einem mehr oder weniger ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus
aus, d.h. dass die Knochen von männlichen Individuen i.d.R. länger
und kräftiger sind als bei weiblichen Individuen aus derselben Gruppe.
Auch bei diesem Kriterium spielen allerdings die Ernährung und die Belastung
des jeweiligen Individuums eine große Rolle, ebenso die Zugehörigkeit
zu bestimmten Volksgruppen. So sind beispielsweise Asiaten heute meist zierlicher
und kleiner als ihre jeweiligen Alters- und Geschlechtsgenossen europäischer
Herkunft; entsprechend können sich die verschiedenen historischen Bevölkerungspopulationen
unterscheiden. Die wichtigsten geschlechtsspezifischen Unterschiede am Skelett
betreffen das Becken (z.B. Winkelung von Beckenknochen zueinander, Ausprägung
bestimmter Knochenpunkte) und den Schädel (z. B. stärkere Ausprägung
von Kinn und äußerer Unterkieferregion beim Mann). Die Ausprägung
dieser Skelettmerkmale ist nach der Pubertät am größten. Deshalb
kann bei jüngeren Individuen die Geschlechtsbestimmung rein aufgrund der
osteologischen Beurteilung schwierig bis unmöglich sein und wird dann soweit
möglich durch molekularbiologische Methoden ergänzt (s.u.).
Eine Untersuchung der Knochen- bzw. Zahnstruktur auf (elektronen?)mikroskopischer Ebene, durch Röntgenverfahren oder chemische Analysen rundet die osteologische Evaluierung weiter ab, ebenso die Altersbestimmung des Skelettfundes an sich – also die Beurteilung, wie lange es bereits im Boden etc. gelegen hat. Mumifizierte Überreste, Reste von Leichenbränden und solche Skelettreste, die stark mit anderen Materialien verhaftet sind, werden i.d.R. im Fundzusammenhang belassen und mittels bildgebender Verfahren wie Röntgen, Computertomographie etc. weiter untersucht.
Spurenelement- und Isotopen-Analyse
Die verschiedenen Nährstoffe, die ein Individuum zu sich nimmt, weisen unterschiedliche Konzentrationen der jeweiligen Spurenelemente und Isotopen auf, so dass bei der chemischen Analyse des Knochenmaterials zum Beispiel zwischen pflanzlicher und tierischer Nahrung unterschieden werden kann. Bei überwiegender vegetarischer Ernährung reichern sich so insbesondere die Elemente Barium und Strontium an, da diese in pflanzlichem Material stärker konzentriert sind als in Nahrungsanteilen tierischen Ursprungs. Ebenso kann durch die chemische Analyse untersucht werden, ob die Nahrung etwa überwiegend aus dem marinen Bereich stammt, oder ob sie mit bestimmten Schadstoffen wie Schwermetallen belastet war (nach Jantzen und Freder, 2005).
Paläogenetik
Die Paläogenetik analysiert genetische
Proben fossiler und prähistorischer Überreste von Organismen und erlaubt
damit, evolutionäre Zusammenhänge aufzudecken, aber auch die Zuchtgeschichte
von Kulturpflanzen und Tieren zu studieren. Paläogenetische Methoden erlauben
ebenfalls den Nachweis bestimmter Mikroorganismen, so dass diese Methode sogar
Daten zur Verbreitung von Krankheitserregern sowie zur evolutionären Entwicklung
von Parasiten oder Viren etc. liefern kann. Ein aktuelles Beispiel hierfür
ist die Analyse der jeweiligen Grippe-Virus-Subtypen anhand von Virusmaterial,
das von Bestatteten der letzten großen Grippe-Pandemien im 19. und 20.
Jahrhundert gewonnen wurde.
Voraussetzung ist die Gewinnung und molekularbiologische Analyse des erhaltenen
Erbmaterials, der so genannten ‚alten DNA', die auch aus jahrtausendealten
Überresten noch extrahiert werden kann. Organische Überreste wie Knochen
und Zähne, die sich in der Regel auch am besten im Boden halten, sind dafür
gut geeignet. Eine der wichtigsten Fragestellungen der Paläogenetik ist
sicherlich die nach der Entstehung des ‚modernen Menschen’ Homo sapiens, seinen
Wanderbewegungen und weltweiten Ausbreitung. Um die genetische Herkunft von
historischem Material herauszufinden, nutzt man insbesondere die mitochondriale
und die Y-chromosomale DNA. Mitochondrien sind Zellorganellen, die eigene
DNA besitzen, welche nur über die mütterliche Eizelle vererbt wird
und – in diesem Zusammenhang besonders wichtig - keiner Rekombination (wie bei
Vermehrung des Erbmaterial der Geschlechtszellen selber ) unterliegt. Die Analyse
der mitochondrialen DNA eignet sich daher für die Erforschung individueller
genetischer Unterschiede. Aufgrund bestimmter Variationen oder ihrer Abwesenheit
im mitochondrialen DNA-Material (die als Haplotypen zusammengefasst werden)
können verschiedene Bevölkerungspopulationen, so genannte Ethnien,
unterschieden werden. Das Y-Chromosom, das nur männlich determinierenden
Samenzellen eigen ist, beinhaltet den größten nicht-rekombinierenden
Genabschnitt des menschlichen Genoms und liefert damit wertvolle Informationen
zur Haplotypisierung.
Gestaltrekonstruktion
Auf Basis von osteometrischen Daten kann auch eine Gesichts- oder Gestaltrekonstruktion versucht werden. Dabei werden die verfügbaren knöchernen Anhaltspunkte dreidimensional als Basis für die Rekonstruktionsversuche erfasst. Für das mittelalterliche Dorf Diepensee, das im Rahmen des Berliner Hauptstadtflughafens ergraben wurde, haben Forscher der Berliner Charité und des brandenburgischen Landesdenkmalamtes versucht, das Gesicht eines toten Mannes aus einem Kopfnischengrab zu rekonstruieren (Eickhoff, 2006c). Anhand der Knochenstruktur des erhaltenen Schädels wurden die einzelnen Weichgewebe, also Haut, Muskeln, Knorpel und Fett sowie die einzelnen Gesichtsteile wie Augen, Nase und Mund nachgebildet. Diese wurden als Weichteilraster auf den Schädel projiziert und dienten damit als Grundlage für eine erste zeichnerische Umsetzung des Gesichts. Die digitale Nachbildung der Weichteilgewebe wurden dann um die Ergebnisse der antthropologischen Untersuchung – Alter, Geschlecht, Körpergröße und –statur, Gesundheits- und Ernährungszustand etc. – ergänzt. So war der entsprechende Mann 48 bis 55 Jahr alt, sein Skelett zeigte eine sehr gute Verfassung und wies keinerlei Mangel- oder Verschleißerscheinungen auf, jedoch Hinweise auf einen Nasenbeinbruch (Eickhoff, 2006c).
Paläodemographische Analyse
Die Daten, die durch die osteologische und die genetische Untersuchung gewonnen wurden, können dann für eine so genannte paläodemographische Analyse genutzt werden. Sind die Daten zu Sterbealter, Geschlecht und Zusammensetzung der Skelettpopulation bekannt, können daraus über statistische Analysen Informationen über Verteilungen, Entwicklung und Dichte vor allem solcher menschlicher Gruppen oder Bevölkerungen erlangt werden, von denen keine schriftlichen Quellen vorliegen. Im besten Falle lassen sich anhand des paläodemographischen Wandels Populationen in Raum und Zeit verfolgen – etwa die Ausbreitung bestimmter Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel der Slawen im Rahmen der Völkerwanderung oder „Einwanderungswellen“ deutscher Siedler im Rahmen der hochmittelalterlichen Ostkolonisation etc.
Als anschauliches Beispiel für Erkenntnisse aus der Paläodemographie
sollen hier die aktuellen Ergebnisse einer paläoanthropologischen Untersuchung
der mittelalterlichen Skelette von Usedom (Freder, 2010) zusammengefasst werden:
Hiefür wurden die Skelette aus einem spätslawischen, frühchristlichen
Kirchfriedhof des 12./frühen 13. Jahrhunderts bearbeitet.
Die ermittelte Altersverteilung war typisch für das
Mittelalter, ebenso die Kindersterblichkeit mit einem
Drittel der altersbestimmten Bevölkerung, wobei die sehr jungen Kinder
(Infans I) mit ca. 21% eine doppelt so hohe Sterbewahrscheinlichkeit aufwiesen
wie die älteren Kinder (Infans II) mit ca. 11 %. Jüngere Kinder starben
häufiger, oft mit einem Alter von 3 bis 4 Jahren. Dies war meist das Alter
des Entwöhnens, also des Abstillens und der kompletten Umstellung auf Entwöhnungskost
(Getreidebreie, in Brühe eingeweichtes Brot etc.), die i.d. R. nicht den
Anforderungen des kindlichen Organismus genügte und durch Mangelernährung
eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit und Sterblichkeit verursachte.
Besonders interessant ist, dass in der Gruppe der jüngeren Kinder die Sterblichkeit
der Mädchen dreimal so hoch war wie die der Jungen. Das kann einerseits
damit erklärt werden, dass Mädchen generell, aber wohl eher ‚unbewusst’
vernachlässigt oder benachteiligt wurden: nach historischen Quellen wurden
sie wohl früher entwöhnt und mit nicht so hochwertiger Nahrung versorgt
wie ihre männlichen Altersgenossen. Andererseits besteht auch die Möglichkeit
des so genannten geschlechterspezifischen Infantizids, also der bewussten
Tötung von Mädchen. Es gibt wohl historische Berichte, wonach missgestaltete
Kinder und auch Mädchen bei den „heidnischen Pommern“ getötet worden
sein sollen, doch erscheint dies nach den archäologisch-anthropologischen
Ergebnissen aus slawischen Gräberfeldern unwahrscheinlich.
Mit 28 % wies die mature Altersklasse einen besonders hohen Anteil auf. Eine
solche ‚Verschiebung’ der höchsten Sterblichkeit in
die höhere Altersklasse kann auf bessere Lebensbedingungen hinweisen oder
auf einen größeren Anteil einer zur Oberschicht gehörenden Teilpopulation,
wie in mittelalterlichen Städten zu erwarten ist.
Die Geschlechterverteilung der untersuchten Skelette setzte
sich aus gut einem Drittel männlicher und knapp einem Drittel weiblicher
Individuen zusammen, das restliche Drittel setzte sich aus Individuen, für
die das Geschlecht nicht eindeutig oder aufgrund von Unvollständigkeit
oder schlechter Erhaltung gar nicht bestimmt werden konnte. Der ermittelte „Maskulinitätsüberschuss“
könnte prinzipiell aufgrund einer Erstbesiedlung oder durch Ortseinwanderung
von Männer bedingt sein, beides könnte für ein aufstrebende Stadt
wie Usedom in der Hochphase der deutschen Ostsiedlung passen, die sicher Handwerker
und generell Arbeitskräfte anzog.
Andererseits käme auch eine höhere Sterblichkeit
von Frauen als Erklärung in Frage. Die generelle Lebenserwartung
zum Zeitpunkt der Geburt lag in Usedom für Frauen bei 29 Jahren und für
Männer mit 38 Jahren deutlich viel höher; wobei sich die Differenz
in der Lebenserwartung im Laufe von Kindheit und Pubertät annäherte
und mit Eintritt in die adulte Altersklasse nur noch 1,8 Jahre betrug. Hatten
Mädchen also die für sie anscheinend deutlich schwierigere (s.o.)
Kindheit überlebt, hatten sie eine etwa vergleichbare Lebenserwartung wie
Männer. Der dennoch niedrigere Wert für ältere Mädchen und
erwachsene Frauen ergibt sich einerseits aus den Risiken von Schwangerschaften
und Geburt, andererseits aber wohl auch aus einem erhöhten Infektrisiko,
das durch Blutarmut (Monatsregel, Blutungen bei Geburt und Fehlgeburten) verursacht
sein könnte. Auch die Eisenversorgung spielt hierfür eine Rolle. Gerade
während des frühen Mittelalters war die Versorgung mit Eisen aufgrund
der vergleichsweise eisenarmen Grundnahrungsmittel Getreide und Gemüse
niedrig und verbesserte sich im hohen und späten Mittelalter v.a. durch
die Versorgung mit Fleisch und Fisch – die aber sicher nicht allen Bevölkerungsschichten
regelmäßig zur Verfügung standen. Für das Usedomer Skelettmaterial
war auch die Fragestellung nach nachweisbarer Zugehörigkeit
zu bestimmten Ethnien sehr interessant – könnten die osteometrischen
Daten im Vergleich mit zeitgleichen Serien aus Nordeuropa und dem Ostseegebiet
(hier wurden andere spätslawische Gräberfelder und die Stadt Haithabu
gewählt) evtl. Hinweise auf eine gemischte Population, z. B. germanischer
und slawischer Bevölkerungsanteile geben? Der ausführliche statistische
Vergleich ergab allerdings in dieser Studie keine entsprechenden verlässlichen
Daten (Freder, 2010).
Bezüglich der regionalen Geschichte von Berlin sind demnächst ähnlich aufschlussreiche Daten zu erwarten. Die äußerst umfangreiche Skelettserie, die bei der Großgrabung am Berliner Petriplatz geborgen wurde, umfasst 3.700 Personen der mittelalterlichen Bevölkerung von Cölln im Zeitraum von etwa 1200 bis 1717 (Melisch und Sewell, 2011). Die noch zu erwartende statistische Auswertung dieser ungewöhnlich großen Stichprobe wird sicherlich höchst interessante Aufschlüsse bezüglich der paläodemographischen Analyse zur mittlelalterlichen Bevölkerung von Cölln ergeben.
Paläopathologie: Erfassung krankhafter Veränderungen
Anhand des historischen Skelettmaterials lassen sich generelle Fehlbildungen, aber auch die Auswirkungen von Mangelernährung, von Fehl- und Überbelastungen, von bestimmter Krankheiten sowie von unfalls- oder gewaltbedingten Verletzungen nachweisen. Die wissenschaftliche Erfassung dieser krankhaften Veränderungen wird als Paläopathologie bezeichnet.
Fehlbildungen
Fehlbildungen, die auf eine gestörte Entwicklung während der Embryonal-/Fetalperiode zurückzuführen sind, sind im historischen Skelettmaterial ebenso vertreten wie heutzutage. Häufige Fehlbildungen betreffen die Ausbildung der Kiefer sowie die Zahnstellung. Im Bereich der Haus- und Nutztierforschung stellen Veränderungen des Gebisses im Sinne von Zahnreduktion und Zahnfehlstellungen sowie Veränderungen der Schädelmaße wichtige Merkmale für eine beginnende Domestikation von Wildtieren dar.
Fehl-, Mangel- und Unterernährung
Fehl- und Mangel- oder Unterernährung können ebenfalls Veränderungen am Skelettsystem hervorrufen – insbesondere dann, wenn sie in den Wachstumsphasen des Körpers auftreten. Solche Veränderungen sind entsprechend besonders häufig im Fundgut anzutreffen und betreffen, wie aus der paläodemographischen Analyse hervorgeht, besonders junge Menschen, dabei Mädchen häufiger als Jungen, und generell eher die unteren Bevölkerungsschichten (s.o.). Sehr oft sind so genannte rachitische Knochenveränderungen festzustellen (bei Erwachsenen spricht man statt von Rachitis von Osteomalazie); sogar am Skelettmaterial alter ägyptischer Mumien konnten sie festgestellt werden. Das Krankheitsbild wird durch ein unausgeglichenes Verhältnis der Kalzium- und Phosphat-Verfügbarkeit im Körper verursacht, meist durch Vitamin-D-Mangel. Da Kalzium und Phosphat die wichtigsten Bestandteile für die Mineralisierung der Knochen und Hartsubstanzen des Körpers darstellen, zeigen die Erkrankten entsprechend vor allem Verbiegungen der langen Röhrenknochen, die dann entsprechende Fehlstellungen wie O-Beinigkeit im Skelett verursachen. Typisch sind auch knöcherne Auftreibungen, besonders an den bereits erwähnten Wachstumsfugen des noch wachsenden Skeletts. Mangelerscheinungen, die zur Blutarmut (Anämie) führen, können am Skelett anhand der typischerweise auftretenden Porosität des Dachs der Augenhöhle (Cribra orbitalia) diagnostiziert werden. Sie sind auf Eisenmangel und/oder auch Vitamin-C-Mangel (Skorbut) zurückzuführen. Treten solche Skelettveränderungen innerhalb einer Population gehäuft auf, ist dies ein starker Hinweis auf Hungersituationen. Als Zeichen einer wohlstandsbedingte Fehlernährung können dagegen Karies-bedingte Zerstörungen der Zähne gedeutet werden. Aus dem Fundgut des mittelalterlichen Lübecks ist beispielsweise bekannt, dass bei Kindern vor dem Milchzahnwechsel hiervon eher Mädchen, im Dauergebiss eher Jungen betroffen waren. Betroffene Mädchen zeigten gleichzeitig auch rachitische Veränderungen. Eine anthropologische Wertung stützt das bereits oben Ausgeführte: Mädchen wurden früher entwöhnt – ihnen fehlte damit das Vitamin und die Mineralien der Muttermilch – und eher mangelernährt. Das verstärkte Auftreten von Karies bei älteren Jungen könnte darauf hindeuten, dass sie eher mit süßen Speisen „verwöhnt“ wurden als gleichaltrige Mädchen (Mührenberg, 1997/1999a). Andererseits können Karies-Defekte auch entstehen, wenn die Ernährung überwiegend kohlenhydratreich ist, zum Beispiel bei überwiegendem Verzehr von Getreide und Hülsenfrüchten. Diese Ernährung bedingt dann gleichzeitig auch Proteinmangel, der währende des Wachstums typische Querrillen an den Zähnen hinterlässt – die so genannten Schmelzhypoplasien.
Fehl- und Überbelastungen
Zum Symptomenkomplex der Fehl- und Überbelastungen
gehören sicherlich Anzeichen von Gelenksentzündungen (Arthritis)
und chronisch-degenerativen Veränderungen (Arthrosen). Sie betreffen
meist die großen Gelenke des Körpers (Schulter-, Ellenbogen-, Becken-,
Kniegelenk) und die Wirbelsäule. Solche Veränderungen können
auch auf ‚berufsspezifische’ Belastungen des Körpers hinweisen, so hinterlässt
beispielsweise die namensgebende Position des Schneidersitzes entsprechende
Veränderungen an der Beckenfuge etc. Auch der heute bei älteren Frauen
häufiger auftretende Knochenschwund, die Osteoporose, ist am historischen
Skelettmaterial nachweisbar – typisch sind zum Beispiel die nach Knochenschwund
bedingten Frakturen im Bereich der Wirbelsäule folgende Knochenbrückenbildung
(Ankylose) und dadurch bewirkte Verkrümmungen der Wirbelsäule
(Skoliose).
Bezogen auf die jeweilige paläodemographische Analyse lassen sich aus den
Erkenntnissen über Art und Häufigkeit der festgestellten Krankheiten
wiederum interessante soziale Rückschlüsse ziehen. Die Untersuchung
des Skelettmaterials eines Hospital-Friedhofs aus dem Rostocker Stadtkern des
13. bis 18. Jahrhunderts zeigte beispielsweise eine verminderte Krankheitsbelastung
der dort Bestatteten im Vergleich zu zeitgenössischen Skelett-Serien aus
dem ländlichen Bereich. Die geringere Häufigkeit und Schwere der pathologischen
Veränderungen ließen so auf die Angehörigen einer sozial gut
gestellten Schicht schließen (Jantzen und Freder, 2005).
Andere Krankheitsbilder
Weitere am Skelettsystem nachweisbare Krankheiten sind zum Beispiel Knochenkrebs oder Skelettschwund aufgrund Massenzunahme benachbarter Strukturen, wie sie zum Beispiel bei benachbarten Weichteiltumoren oder auch bei krankhaft erweiterten Gefäßen (Aneurysmen) auftreten, die beim Platzen je nach Lokalisation zum Tod durch Verbluten oder starke Thrombosen führen können.
Erhaltene Nieren- oder Blasensteine innerhalb des Skelettverbunds geben Hinweise auf die Verbreitung dieser Krankheit. Blasensteine sind meist durch einseitige Ernährungsgewohnheiten verursacht und können kolikartige Schmerzen verursachen, weswegen sie auch schon im Mittelalter und bis in die Neuzeit durch den so genannten Steinschneider oder Lithotomus entfernt wurden. Von der Ausgrabung am Berliner Petriplatz ist beispielsweise ein faustgroßer Blasenstein aus einem Männergrab erhalten (Melisch und Sewell, 2011). Aber auch kleinkörnige Ablagerungen, die als „Grieß“ bezeichnet werden, können bei sorgfältiger Freilegung erfasst werden.
Infektionskrankheiten
Viele Infektionskrankheiten, die in seuchenhaften Zügen die Bevölkerung vergangener Zeiten heimsuchte, sind auch am erhaltenen Skelettmaterial nachweisbar. Zum einen weisen massenhafte Bestattungen innerhalb eines kurzen Zeitraums auf solche Seuchenzüge wie beispielsweise die aus den zeitgenössischen Schriftquellen nachweisbare Pestepidemien hin.
Eine weitere weitverbreitete Infektionskrankheit stellt die Lepra dar, die durch ein Mykobakterium verursacht wird. Nach oberflächlichem Befall von Hautpartien wird im Laufe der Erkrankung auch das darunterliegende Gewebe durch die Infektion quasi ‚eingeschmolzen’ und aufgelöst, so dass auch am erhaltenen Knochenmaterial typische Defekte entstehen. Die ältesten archäologischen Nachweise von Lepra-bedingten Knochenveränderungen stammen aus der Zeitstellung von 2.000 v. Chr. aus Indien. Der deutsche Name ‚Aussatz’ zeigt schon, dass befallene Menschen isoliert und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, da schon recht früh bekannt war, dass die Krankheit ansteckend ist. Im Mittelalter wurden Lepröse meist in so genannten Leprosorien, Leprahäusern, die oft dem Hl. Lazarus oder dem Hl. Georg (Jürgen) geweiht waren, untergebracht. Aus dem mittelalterlichen Winchester liegt gerade eine aktuelle Studie zu Ausgrabungen im Areal eines Hospitals vor, in der die archäologisch erfassbaren Knochenveränderungen der Lepra hervorragend dokumentiert sind (Roffey und Tucker, 2012). Besonders eindrucksvoll sind sicherlich die Einschmelzungsvorgänge rund um Mund und Nase, die das Gesicht und den darunter liegenden Schädelelemente der Erkrankten massiv entstellten. Mittelalterliche Plastiken, die solche entstellten ‚Lepra-Fratzen’ abbilden, sind bekannt. Auch Hand- und Fußknochen werden oft befallen und zeigen dann entsprechende Auflösungserscheinungen. Lepra-ähnliche Haut- und Skeletterkrankungen können aber auch durch andere Mykoplasmen-Infektionen hervorgerufen werden. Deswegen unterschied man im Mittelalter bereits zwischen „weißer“, nicht-ansteckender, und der „schwarzen“ ansteckenden Form. Die Diagnosefindung hierzu wird in der zeitgenössischen medizinischen Literatur beschrieben.
Eine weitere durch Mykoplasmen verursachte Krankheit ist die Tuberkulose. Sie hinterlässt ebenfalls typische Veränderungen am Skelettsystem. Wie die Lepra wird sie durch Mykobakterien verursacht, beim Menschen meist durch Mycobacterium (M.) tuberculosis, aber auch durch die ebenfalls bei Tieren vorkommenden M. bovis oder M. avium. Historische Bezeichnungen für die Krankheit sind Schwindsucht (lat. consumptio/ne, gr. phtisis) aber auch Skrofulose oder weiße Pest (vergl. Lepra). Gerade der Begriff Skrofulose zeigt in der historischen Anwendung sicherlich Überschneidungen von Lepra- und Tuberkulose-Erkrankungen, insbesondere deren Haut-Manifestationen, und beinhaltet wohl auch Erkrankungen die durch andere Mykobakterien verursacht wurden. Die eigentliche Tuberkulose gehört zu den so genannten Anthropozoonosen, da sie zwischen Tier und Mensch übertragen werden kann. Während man früher davon ausging, dass die Tuberkulose ursprünglich vom Tier auf den Menschen übertragen wurde, zeigen neuere Analysen, dass das überwiegend Menschen-pathogene M. tuberkulosis vermutlich bereits 40.000 Jahre alt ist und sich vermutlich mit der zeitgleich auftretenden Verbreitung des modernen Menschen Homo sapiens sapiens aus Afrika heraus vergesellschaftet. M. bovis ist wohl erst ca. 6.000 Jahre alt und korreliert damit gut mit der beginnenden intensiven Nutztierhaltung innerhalb der frühen Hochkulturen – damit wurde die Krankheit wohl ursprünglich eher vom Menschen auf das Nutzvieh, insbesondere die Wiederkäuer, übertragen (History of tuberculosis, Wikipedia). Während die Hauptbefallsorte durch die Mykobakterien innere Organe wie bei der ‚klassischen Schwindsucht’ die Lunge, aber auch das Gehirn oder eben die Haut sind, ist der Erregerbefall am Skelettsystem seltener und meist durch den engen Kontakt zu befallen benachbarten Weichstrukturen bedingt. Typische Skelettveränderungen sind aufgetriebene oder Hohlkörper-artige Strukturen im Knochen, bestehend aus unregelmäßigen, netzartig verbundenen Knochenbälkchen. Es ist schon länger bekannt, dass steinzeitliche Skelette von vor ca. 9.000 Jahren Tuberkulose-bedingte Veränderungen aufweisen. Auch in ägyptischen Mumien (3.000 bis 2.400 v. Chr.) konnten Tuberkulose-Veränderungen festgestellt werden. Aktuelle Forschungsergebnisse beschreiben Skelettveränderungen an der Innenseite eines ca. 500.000 Jahre alten Homo erectus-Schädels, die vermutlich durch eine Hirnhaut-Tuberkulose (Leptomeningitis tuberculosa) verursacht wurden (Kappelmann et al., 2008). Sollte sich dies bestätigen, wäre die Tuberkulose wohl die älteste nachgewiesene Infektionskrankheit des Menschen. Verlässliche Aussagen zu Häufigkeit oder Verbreitung der Tuberkulose gibt es erst seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert, als die Verbreitung der Krankheit während der dann folgenden 200 Jahre stark zunahm. Robert Koch konnte 1882 das auslösende Mykobakterium nachweisen und 1906 wurde der erste Impfstoff entwickelt/eingesetzt, was dann den Rückgang dieser Seuche bedingte. Neben der Ansteckung über ausgehusteten stark erregerhaltigen Auswurf im Verlauf der so genannten offenen Form der Lungentuberkulose wurde die mit Mykobakterien verseuchte Rohmilch von erkrankten Rindern zu einem wichtigen Verbreitungsfaktor für die Krankheit, so dass auch die Bekämpfung der Rindertuberkulose einen wichtigen Stellenwert einnahm.
Eine weitere große Seuche, die sich in Europa erst nach dem ausgehenden 15. Jahrhundert stärker verbreitete, weil der Erreger wohl durch die Schiffsfahrer aus Amerika eingeschleppt wurde, ist die durch Treponemen verursachte Syphilis. Wenn auch Syphilis-artige Veränderungen an historischem Skelettmaterial aus dem prä-kolumbischen Europa beschrieben wurden, ist bis heute nicht ganz eindeutig geklärt, ob der Erreger neu aus Amerika eingeschleppt wurde oder – evtl. mit anderen Subtypen – bereits vorher in Europa vorkam. Die Seuche, als „Franzosenkrankheit“ oder „große Blattern“ bezeichnet, wurde im 16. Jahrhundert auf sexuellem Wege in ganz Europa verbreitet und führte zur Schließung der bis dahin so beliebten Badehäuser. Im fortgeschrittenen Stadium führt Syphilis dazu, dass Knochen in typischer Weise verdicken und ‚aufquellen’.
Aufschlussreiche Hinterlassenschaften: Koprolithen, Kloakensedimente und die Archäoparasitologie
Als besondere menschliche (oder tierische)
Überreste sind die so genannten Koprolithen oder
Kotsteine zu erwähnen. Hierbei bleiben fäkale Exkremente durch Eintrocknung
erhalten oder werden in meist phosphatischer Erhaltung fossilisiert. Die ältesten
bekannten fossilen tierischen Koprolithen stammen aus einer Zeitstellung von
über 4 Millionen Jahren. Die Analyse von erhaltenen Exkrementen ermöglicht
einerseits Typisierung und ggf. Anteilsbestimmung von tierischen und pflanzlichen
Nahrungsbestandteilen und kann damit die anhand der Spurenelement- bzw. Isotopenanalyse
gewonnen Daten aus den zugehörigen Skelettresten zum Ernährungsstatus
(s.o.) ergänzen. Allerdings handelt es sich bei Koprolithen in der Regel
um Einzel- bzw. Individualfunde. Generellere Aussagen über die Ernährungsweise
der entsprechenden Bevölkerungsgruppe können dagegen aus der Untersuchung
von Kloakensedimenten gewonnen werden, da diese meist
von mehreren Personen genutzt werden. Im Einzelfall gelang es sogar, aus Koprolithen
Fragmente von alter DNA zu isolieren und mittels paläogenetischer Methoden
(s.o.) zu identifizieren. Mit dieser Methode können im besten Fall der
„Erzeuger“ der Kotprobe, die Spezies der enthaltenen Nahrungsbestandteile und/oder
sogar der Nachweis von (normalen sowie krankheitserregenden) Mikroorganismen
aus dem Darm bestimmt werden.
So wurde zum Beispiel mittels Sequenzanalyse die Darmflora aus Koprolithen bestimmt,
die von verschieden Ausgrabungsstätten (8.000 bis 1.4000 Jahre v. Chr.)
aus den Südstaaten der USA, Chile und Mexico stammten, und mit der normalen
Darmflora heutiger Menschen unter verschiedenen Lebensbedingungen verglichen.
Dabei wurde herausgefunden, dass sich die Darmflora beim modernen Menschen durch
die zivilisationsbedingte Lebensweise anscheinend stark verändert hat (Tito
et al., 2012).
Die Untersuchung von Koprolithen und Kloakensedimenten gehört auch in den Bereich der so genannten Paläoparasitologie. So können in den erhaltenen Fäkalresten oft genug noch Nachweise eines Befalls mit Endoparasiten wie Spul- (Ascaris lumbricoides) oder Peitschenwürmern (Trichuris trichuria), Leberegeln (Fasciola hepatica) oder so genannten Fischbandwürmenr (Diphyllobothrium latum) geführt werden. In der Regel bleiben in den Fäkalgruben die besonders resistenten Eier und/oder Dauerformen von Parasiten erhalten, die dann genauer bestimmt werden und eine Übersicht über den entspechenden Gesundheits- bzw. Durchseuchungszustand der jeweiligen Bevölkerungsgruppe geben können. Eine weitere Form der Bestimmung des individuellen Parasitenstatus bei Bestattungen mit gutem Erhaltungszustand wie z. B. isolierten Grablegungen stellt die Möglichkeit dar, Erdpoben direkt aus dem Bauchbereich der ergrabenen Leiche zu nehmen – also im Umfeld des unteren Brustkorb- bzw. unteren Wirbelsäulenbereichs ab dem ersten Lendenwirbel kaudalwärts. Hier können evtl. ebenfalls noch Nachweise von Parasiteneiern geführt werden. Ein individueller Befall mit Bandwürmer (Cestoden) kann evtl. bestimmt werden, wenn die Dauerstadien im Gewebe des Wirts (Mensch oder Tier), die so genannten Bandwurmzysten, in Form von ca. haselnussgroßen Gebilden mit dünnwandiger verkalkter Schale am Skelett erhalten bleiben. (nach Ansorge und Frenzel, 2005; Hermann et al., 1990)
Fächerübergreifende Fundinterpretation: Paläoosteologie „meets“ Anthropologie
Die durch die paläoosteologische bzw. paläopathologische Untersuchung gewonnenen Fakten können häufig erst durch Berücksichtigung anthropologischer Gesichtspunkte in einen genaueren Zusammenhang gestellt werden. Als Beispiel wurde bereits der Verdacht des geschlechterspezifischen Infantizids genannt, der aufgrund der paläodemographischen Skelettanalyse geäußert aber durch Einbeziehung anderer zeitgenössischer Quellen auszuschließen war (s.o.).
Unfälle und Gewalteinwirkung, Strafen
Sehr häufig können Paläopathologen auch die Anzeichen von nicht oder nur schlecht verheilten Knochenbrüchen nachweisen. Diese sind besonders oft an Skeletten zu finden, die ärmeren Bevölkerungsschichten zuzuordnen sind. Wahrscheinlich hatten diese Personen weder die Zeit noch das Geld, zumindest eine einfache Schienung mit Schonung der gebrochenen Knochen zu ermöglichen. Der anthropologische Befund zeigt hier oft so genannte Pseudarthrosen, das sind krankhaft gebildete gelenkähnliche Formationen im Bereich des Bruchs, die durch die fehlende Ruhigstellung der betroffenen Körperregion entstanden sind. Folge eines stattgefundenen Bruchs können auch verkürzte Gliedmaßenknochen sein, insbesondere dann, wenn der Bruch noch während der Kindheit, also in der Knochenwachstumsphase, stattgefunden hat. Betrifft diese einseitige Verkürzung die Beinknochen, sind durch die dadurch verursachte Fehlhaltung in der Regel auch die Beckenknochen sekundär arthrotisch verändert. Offene Wunden führen durch das Eindringen von Schmutzkeimen oft zu ausgedehnten Wundinfektionen, die im schlimmsten Falls durch Erregerausbreitung auf den gesamten Körper in Form des Wundbrandes zum Tode führen. Dringen die Keime durch offene Knochenbrüche in die Knochenhöhle ein, können raumgreifende Knochenmarksentzündungen zu schweren Knochen- und Gelenks-Deformationen führen, die auch archäologisch nachweisbar sind. Oft genug sind auch die Folgen von Gewalteinwirkung durch Waffen oder Knüppel etc. nachzuweisen. Erstaunlich oft werden an historischen Skeletten schwere Hieb- oder Stichwunden nachgewiesen, die überlebt wurden – am veränderten Knochen ist dies durch entsprechende reparative Auftreibungen erkenntlich. Selbst am Schädel sind solche überlebten schweren Gewalteinwirkungen nachweisbar.
Im Fundzusammenhang können die Spuren von Gewalteinwirkung auch als Folge von – meist mittelalterlicher - Strafanwendungen eingeordnet werden. In Grabungsbereichen von Gefängnissen oder Fronhöfen werden beispielsweise öfter die Knochen von ganzen menschlichen Händen im Sehnenzusammenhang gefunden, dabei ist i.d.R. erkennbar, dass diese Körperteile ‚sauber’ vom Körper mit einem scharfen Hieb- oder Schnitt-Instrument entfernt wurden. Das Handabhacken als Strafe zum Beispiel für Diebe ist ja auch aus anderen zeitgenössischen Quellen wie bildlichen Darstellungen und Schriftquellen bekannt. Im Fronhof des mittelalterlichen Lübeck wurden die Knochen eines eindeutig amputierten Fußes gefunden. Die anthropologische Untersuchung ergab, dass die Amputation wohl aus medizinischen Gründen als Schutz vor Wundbrand erfolgt sei, da an den Zehen die Anzeichen schwerer Entzündungen mit Knochenauflösungen nachgewiesen werden konnten. Diese wurden vermutlich dadurch verursacht, dass während der ‚hochnotpeinlichen Befragung’, also während der Folter, die Zehen mit glühenden Zangen bis auf die Knochen verletzt wurden (Mührenberg, 1997/1999b).
Auch ein Gewaltverbrechen konnte vermutlich durch die Lübecker Archäologen nachgewiesen werden: In der Kloake eines Hauses der Lübecker Holstenstraße wurde ein komplettes menschliches Skelett gefunden. Es soll Fälle gegeben haben, in denen Menschen (vielleicht unter Einwirkung von Alkohol) bei Verrichtung ihrer Notdurft aus Versehen in die Kloake fielen und ertranken. Bei solchen Unfällen war den Angehörigen doch meist daran gelegen, den Leichnam zu bergen und ordnungsgemäß zu beerdigen. Im Lübecker Fall waren die Anzeichen für einen Mord auch noch nach über 500 Jahren ersichtlich – dem Mann waren die Arme gebrochen worden und er war regelrecht zusammengeschnürt worden (Mührenberg, 1997/1999b).
Heilkundlich oder Ritual-motivierte Eingriffe
Eine weitere Sonderform der festgestellten
pathologischen Veränderungen an historischem Skelettmaterial ist wohl heilkundlicher
oder Ritual-motivierter Eingriffe zuzuschreiben.
Eine der ältesten bekannten heilkundlichen Eingriffe ist die so genannte
Schädel-Trepanation, bei der die Schädelwand
mittels eines bohrenden Instruments eröffnet wird. So verursachte Schädelöffnungen
können bereits von menschlichen Überresten um 10.000 v. Chr. aus Frankreich
und aus späteren Zeitstellungen weltweit nachgewiesen werden. In Europa
sind mehr als 450 Trepanationen aus der Jungsteinzeit (Neolithikum) bekannt.
Trepanierte Schädel liegen aus altägyptischer Zeitstellung, begleitet
von entsprechenden Beschreibungen in alten Papyrusschriften, sowie auch aus
Südamerika vor. Hier wurden auch passende chirurgische Werkzeuge für
diesen Eingriff gefunden. Ob die vorzeitlichen Trepanationen religiös oder
medizinisch motiviert waren, ist allerdings umstritten. Die ritualisierte Motivation
wird unter anderem dadurch gestützt, dass entnommene Schädelstücke
nach dem Eingriff nicht wieder eingesetzt wurden (wo sie verheilen könnten),
sondern durchbohrt wurden, um wohl als Amulett oder Ähnliches getragen
zu werden. Der antike Arzt Hippokrates (ca. 460 – 370 v. Chr.) benutzte für
medizinisch motivierte Schädelöffnungen bereits modern anmutende Perforativ-
und Kronentrepane. Während die Trepanation im Frühmittelalter wohl
im christlichen Mittelalter verboten war, wurde ab dem 13. Jahrhundert wieder
öfter trepaniert. Zeitgenössische Abbildungen und Beschreibungen,
wie zum Beispiel illustrierte Handschriften der ‚Chirurgia’ des Roger (oder
Roland) von Parma (* um 1140; † 1195) zeigen dies. Damals setzte man Hammer,
Meißel, Messer und primitive Schraub- und Bohrapparate ein.
Ortholog, d.h. ohne überschiessende Knochenbildung und mit natürlicher Position der Bruchenden und ohne Pseudarthrosenbildung (siehe oben) verheilte Knochenfrakturen können ebenfalls paläoosteologisch nachgewiesen werden. Dies setzt eine Behandlung des Knochenbruchs mit Fixierung und evtl. Ruhigstellung voraus. Entsprechende Beschreibung für Reposition der Bruchenden sowie Bandagierung oder Schienen sind aus den Anfängen der modernen Medizin erhalten. Im Mittelalter war die Knochenbruchbehandlung oft Aufgabe der Wundärzte. Zeitgenössische Abbildungen zeigen Bandagierungen und Schienung verletzter Körperteile.
Das historische Knochenmaterial verrät auch, dass zahnmedizinische Eingriffe vorgenommen wurden. Ein sehr altes Beispiel für Zahnfüllungen stellt der Fund jungsteinzeitlicher Kieferfragmente aus Slowenien dar, bei dem an einem Eckzahn eine ‚Plombe’ aus Bienenwachs nachgewiesen werden konnte. Der gefüllte Eckzahn wies einen deutlichen Riss auf, was eine therapeutisch-schmerzlindernde Füllung mit Bienenwachs erklären könnte. Allerdings ist in diesem Fall nicht ganz eindeutig, ob das Bienenwachs vor oder nach dem Tod des Individuums eingefügt wurde (Bernadini et al., 2012). Auch zahnmedizinisch motivierte Bohrungen sind aus der Frühgeschichte bereits dokumentiert worden, so weisen 9.000 bis 7.500 Jahre alte Backenzähne aus Pakistan Bohrlöcher auf, die aus medizinischen Gründen zu Lebzeiten vorgenommen wurden (Coppa et al., 2006). Aus anderen Zeitstellungen wurde Füllungsmaterial wie Pech, Porzellan oder Edelmetalle nachgewiesen. Auch Zahnersatz, aus Holz, Elfenbein oder Tierknochen gefertigt, sowie der Einsatz von Zähnen Verstorbener als Zahnprothese sind belegt. Die Prothesen wurden zum Beispiel mit Golddraht an den Nachbarzähnen befestigt. Dieses Verfahren wurde auch zur Fixierung gelockerter Zähne verwendet. Einer der frühesten archäologischen Nachweise für Mitteleuropa stammt aus einem spätslawischen Gräberfeld des 12. Jahrhunderts.
Bannriten
Die Osteoarchäologie kann auch
Hinweise auf so genannte Bannriten und besondere Bestattungspraktiken geben.
Aus der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossene Tote, wie Ungläubige, Verbrecher
oder Selbstmörder wurden oft separat und entgegen der sonst üblichen
Bestattungsweise in west-östlicher Richtung (die am Tag der Auferstehung
den Blick auf das im Osten liegende Jerusalem ermöglichen sollte) in Nord-Süd-Richtung
bestattet. Hinweise auf Bannriten, die das ‚Wiederkehren’ von zu Lebzeiten anscheinend
unheimlichen Verstorbenen verhindern sollten, sind Verstümmelungen der
Toten wie zum Beispiel das Abtrennen der Beine. Auch wenn im Grab große
Steine auf den Schädel und/oder die Hüften platziert wurden, wird
dies als Bannritus gegen ‚Wiedergänger’ gewertet. Solche Praktiken sind
beispielsweise aus dem mittelalterlichen Dorf Diepensee bekannt, das im Rahmen
der Errichtung des Flughafens BBI ergraben wurde (Eickhoff, 2006b).
Ethnographica und Reliquien
In den Formenkreis der seltenen Erhaltungsformen menschlicher (und tierischer) Überreste können Mumien und Moorleichen eingeordnet werden. Zusätzlich gehören dazu auch so genannte Ethnographica und Reliqiuen. Als Ethnographica bezeichnet man menschliche Überreste aus ethnographischen Sammlungen, die dort als Bestanteil von Gebrauchsgegenständen (z. B. Schädel als Kopfstützen; Dolche oder Messer, die aus menschlichen Oberschenkelknochen gefertigt wurden), Trophäen (Schrumpfköpfe, Skalp), kultische Objekte (Amulette mit menschlichen Knochenanteilen, Schädelbecher etc. ) oder Produkte des Totenkultes (Mumien etc.) vorliegen. Auch hier können evtl. mit osteologischen und molekularbiologischen Methoden Daten über die biologischen Identitätsmerkmale (Geschlecht, Alter, Ethnie) gewonnen werden. (nach Hermann et al., 1990)
Hinweise auf Praktiken zur Körperhygiene
Sozusagen als „Nebenbefund“ der Osteoarchäologie kann man den erhaltenen Knochen beiliegende oder mit ihnen durch Korrosion verbundene Objekte anführen. Neben Schmuckelementen und Kleidungsaccessoires sind dies oft auch Elemente, die dem Bereich Körperhygiene zugeordnet werden. In der bereits erwähnten Grabung am Berliner Petriplatz wurde beispielsweise ein eisernes Pessar an einem Schambein gefunden, und auch Pinzettenfunde waren wohl relativ häufig (Melisch und Sewell, 2011).
Dieser Artikel erschien bereits
in stark gekürzter Form in:
Hirschberg RM. Knochen & Co oder: Was vom Menschen übrig blieb. Karfunkel
Codex 11 - Heilkunde im Mittelalter, 2013, 132-141
Verwendete Quellen und weiterführende exemplarische Literatur:
Internet-Links zu Methoden und wissenschaftlichen Gesellschaften: